
| Technologievergleich und Ökobilanz von Abwasserreinigungsanlagen in alpinen Extremlagen | 
|
Ökonomischer Aufwand und ökologischer Nutzen von Kläranlagen im Gebirge |
Einleitung
Kostenanalyse
Nutzenanalyse
Errichtungskosten und Ökobilanz
Prioritätenreihung
Kostenentwicklung
Schlussfolgerung
- dem technisch Machbaren,
- dem wirtschaftlich Vertretbaren,
- dem ökologisch Sinnvollen und
- dem gesetzlich Vorgeschriebenen
Treten in einem dieser Aspekte Änderungen ein, dann werden Fragen aus den anderen Bereichen beu reflektiert.
Im Titel des Life-Projektes wurde das etwas plakative Schlagwort "Ökobilanz" verwendet: Damit ist der Versuch gemeint, Wirtschaftlichkeit und Nutzen von Abwasserprojekten in Extremlagen einfach und für jeden nachvollziehbar zu quantifizieren. Ein solches Vorhaben erscheint vor allem für den Fördermittelgeber aber auch für den Gesetzgeber von Interesse. Angesicht der großen Bandbreite örtlicher Randbedingungen ist es wichtig, projektunabhängige Maßstäbe zu finden.
Die Dringlichkeit und Förderungswürdigkeit eines Projektes sollte objektivierbar sein. Verwaltungsvereinfachung wird von beiden Seiten der durchzuführenden Förderungsverfahren gewünscht. Preisangemessenheit wird vor allem von den Zahlern gefordert....
Dazu wurden 10 Randbedingungen betrachtet, die auch im ÖWAV-Regelblatt 1 unter Punkt 3 (Örtliche Verhältnisse bzw. Randbedingungen) näher beschrieben sind. Diese Randbedingungen werden als einzelne Einflussfaktoren auf die Projektkosten in einer einheitlichen Dimension zusammengefasst. Das heißt, es sollen für jede Randbedingung Aufwand- oder Erschwernisklassen gebildet werden, in die jedes anstehende Projekt eingeordnet werden kann. Dazu ist es notwendig, jeder Randbedingung hinsichtlich ihrer Kostenrelevanz eine Gewichtung zuzuschreiben. Die Anzahl der Gewichte einer Randbedingung sind ein Maß für die Erschwernis, die von dieser vorhandenen Randbedingung ausgeht. Die Summe der Gewichte aller Randbedingungen einer projektierten Anlage sind dann ein Maß für den zu erwartenden Aufwand.
Aufwand A = Summe der Gewichte (1 - 10)Für diese Art der Aufwandsermittlung wird die nachfolgend angegebene Gewichtung der einzelnen Erschwernisse vorgeschlagen (siehe Abb. 1):
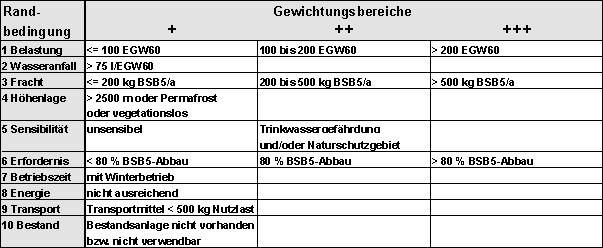
Abb. 1: Vorgeschlagene Gewichtung der Erschwernisse, die von einzelnen Randbedingungen ausgehen
Die Möglichkeiten, die sich durch eine solcherart standardisierte Aufwandsermittlung ergeben, sind vielfältig: Die aufwandspezifischen Kosten (AK) geben eine klare Auskunft über die Wirtschaftlichkeit des analysierten Projektes. Werden die Kosten aller 15 Life-Anlagen auf diese Weise analysiert, dann liegt eine repräsentative Datensammlung (Preisdatei) vor, um die Preisangemessenheit späterer Projekte überprüfen zu können. Diese Idee wird bereits mit der Landespreisdatei für Siedlungswasserbauten in Tirol verfolgt. In dieser Preisdatei werden ständig aktualisiert die mittleren Einheitspreise von Standardausschreibungspositionen von Projekten geführt, die zur Förderung eingereicht werden. Diese Einheitspreise sind jedoch für kleine Baumaßnahmen im Gebirge nicht anwendbar. Anstelle von detaillierten Preisvergleichen können hier generell die aufwandspezifischen Kosten eines Projektes mit denen der gesammelten Daten verglichen werden. Der Bauherr kann durch die ermittelten Aufwandswerte anstehende Investitionen kalkulieren und budgetieren.
Das Land als Fördermittelgeber hätte weiters die Möglichkeit, zulässige Grenzen an aufwandspezifischen Kosten festzulegen, bis zu denen die Förderbarkeit reicht. Die aufwandspezifischen Kosten der 15 betrachteten Anlagen liegen im Mittel bei 160.000,- ATS, variieren jedoch von 39.000,- bis 349.000,- ATS. Durch die Begrenzung der förderfähigen Kosten z.B. auf 160.000,- ATS pro Aufwandswert und volle Eigenfinanzierung der darüber hinausgehenden Kosten durch den Bauherrn wird einerseits Fördergeld gespart und andererseits Druck auf den Bauherrn und damit auf den Planer ausgeübt, möglichst preisgünstige Verfahrensvarianten zu suchen. Der mittlere Aufwandswert der 15 Life-Anlagen betrug 9,2 Gewichte und das ergibt mittlere Investitionskosten von 1,5 Millionen Schilling pro Anlage. Durch Fördergrenzen bei den aufwandspezifischen Kosten ergibt sich keine absolute Obergrenze der förderfähigen Kosten bei 1,5 Mio ATS pro Anlage, sondern die Kosten können bei sehr ungünstigen Randbedingungen deutlich darüber und bei sehr einfachen Verhältnissen allerdings deutlich darunter liegen. Weiterführend könnte auch eine pauschalierte Förderung nach Aufwandswerten in Erwägung gezogen werden. Im Vergleich zur anteiligen Förderung könnte damit der Kontroll- und Verwaltungsaufwand bei der Förderungsabwicklung deutlich gesenkt werden.
"... Der mit der Erfüllung dieser Maßnahmen verbundene Aufwand darf nicht außer Verhältnis zu dem damit angestrebten Erfolg stehen, wobei insbesondere Art, Menge und Gefährlichkeit der von der Wasserbenutzung ausgehenden Auswirkungen ... zu berücksichtigen sind. ..."
Die Definition für den Erfolg wasserwirtschaftlicher Maßnahmen kann auf den ökologischen Nutzen einer Abwasserreinigungsanlage übertragen werden: Art und Menge der Auswirkungen werden durch Belastung(1), Abwasseranfall(2) und Jahresfracht(3) definiert, während die Gefährlichkeit durch Standortsensibilität(5) und Höhenlage(4) ausgedrückt wird. Es soll nun analog zur Aufwandermittlung der Umweltnutzen eines Projektes ermittelt werden. Bei der Gewichtung des Nutzens kommen, wie eben aufgezählt, nur die ersten 5 Randbedingungen zum Tragen. Um die Bedeutung der Standortsensibilität(5) zu betonen, treten die Gewichte dieser Randbedingung als Multiplikand auf:
Nutzen N = Summe der Gewichte (1 - 4) x Gewichte (5)
Der Nutzen von 5 Life-Projekten wurde nach dieser vorgeschlagenen Formel ermittelt und in der vorangegangenen Tabelle angeführt. Die nutzenspezifischen Kosten (NK) wiederum sind die Projektkosten bezogen auf die Nutzengewichte. Aufwandspezifische- und nutzenspezifische Kosten können sehr unterschiedlich sein. So bedeuten niedere AK und hohe NK, dass die gegenständliche Anlage preisgünstig erstellt wurde, jedoch wenig Umweltrelevanz aufweist. Mit der vorgeschlagenen oder einer ähnlichen Vorgangsweise kann der Umweltnutzen eines Projektes quantifiziert werden, ohne ausführliche Gutachten zu erstellen.
Objekt Belastung
max EGW60Errichtungskosten
ATSspez. Kosten
ATS/EW60Berliner Hütte 260 1008988 3881 Brandenburger Haus 60 347146 5786 Brunnstein Hütte 115 2246126 19532 Coburger Hütte 180 2354024 13078 Darmstädter Hütte 75 872041 11627 Essener / Rostocker H. 157 2715271 17295 Hermann v. Barth Hütte 84 1675114 19942 Höllental-Anger Hütte 215 3080000 14326 Karlsbader Hütte 104 1545304 14859 Konstanzer Hütte 110 598599 5442 Lamsenjoch Hütte 200 1456696 7283 Magdeburger Hütte 100 545203 5452 Nördlinger Hütte 112 1154890 10312 Porze Hütte 78 2129745 27304 Stuttgarter Hütte 150 656574 4377
Abb. 2: Gesamterrichtugnskosten und einwohnerspezifische Kosten der Life-Kläranlagen
Objekt Randbedingung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belast-
ungWasser-
anfallFracht Höhen-
lageSensi-
bilitätErforder-
nisBetrieb Energie Transport Bestands-
anlagemax EGW60 max m3/d kg BSB5/a m ü. Meer Gefähr-
dungBSB5-
AbbauSaison Art u. kW Fahrzeug Typ, baul. Zustand, Volumen l/EW Berliner Hütte 260 18 700 2040 großer
Vorfluter80% Sommer KWKW 50 Material-
seilbahn14-Kammer, guter Zustand, 140 Branden--
burger Haus60 0.37 300 3274 keine
Quellen Urgest.40% Sommer Agg. Hub-
schrauberdirekte Ausleitung Brunnstein Hütte 115 1.5 278 1560 Natur-
schutz-
gebiet>80% Sommer FV 0.9, Agg.11 Material-
seilbahn2-Kammer, schlechter Zustand,
13Coburger
Hütte180 6.4 280 1970 Quelle, Kalk 90% Sommer FV 0.3, Agg.17 Material-
seilbahnFettfang, 2-Kammer, baufällig Darmstädter Hütte 75 5.3 215 2384 keine Qu., Urgest. 40% Sommer KWKW 12 3.5 t < 4WD 3-Kammer, schlechter Zustand,
93Essener / Rostocker H. 157 7.55 400 2208 Urgestein 80% So / Wi KWKW Material-
seilbahn3-Kammer, schlechter Zustand Hermann v. Barth Hütte 84 5.1 140 2129 Kalk 80% Sommer FV u. Agg. Material-
seilbahndirekte Ausleitung Höllental-
Anger Hütte215 10 700 1379 Natur-
schutz-
gebiet< 40 mg/l Sommer Agg. 32 / 45 Material-
seilbahn3-Kammer,
guter Zustand, 140Karlsbader Hütte 104 6 380 2260 Quellen 80% Sommer Aggregat LKW 3-Kammer, schlechter Zustand, 432 Konstanzer Hütte 110 11 230 1708 großer
Vorfluter80% Sommer KWKW 22 LKW beheizte Anaerob-
biologie, gut,
190Lamsenjoch Hütte 200 15 490 1958 Natur-
schutz-
gebiet80% Sommer Aggregat 4WD 2-Kammer, schlechter Zustand,
57Magdeburger Hütte 100 5 123 1633 Natur-
schutz-
gebiet80% Sommer FV 0.4, Agg.3 LKW 3-Kammer, guter Zustand, 156 Nördlinger Hütte 112 3.3 195 2238 Natur-
schutz-
gebiet80% Sommer FV 1.7, Agg.3 Material-
seilbahn3-Kammer, guter Zustand,
72Porze Hütte 78 3.1 180 1930 Kalk 80% Sommer Fotovoltaik LKW 2-Kammer, schlechter Zustand,
38Stuttgarter Hütte 150 10 400 2319 Quelle, Kalk 80% Sommer Netz-
anschlussMaterial-
seilbahn3-Kammer, guter Zustand, 223 Abb. 3: Randbedingungen der Life-Kläranlagen
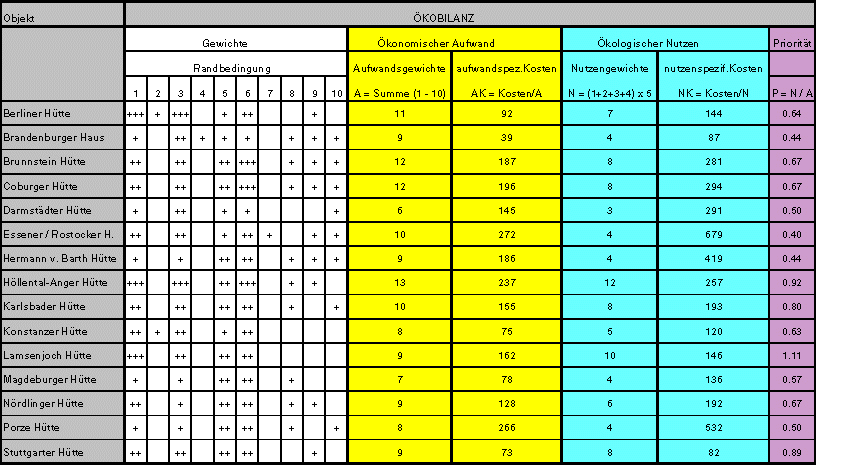
Abb. 4: Ökobilanz der Life-Kläranlagen unter Berücksichtigung örtlicher Erschwernisse und ökologischem Nutzen
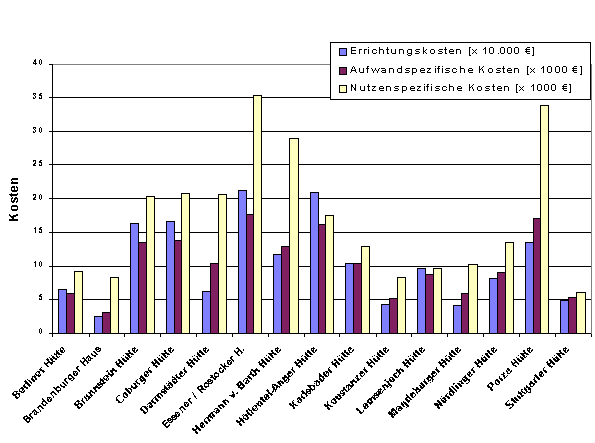
Abb. 5: Die Errichtungskosten der Life-Kläranlagen bezogen auf deren ermittelte Aufwände und Nutzen.
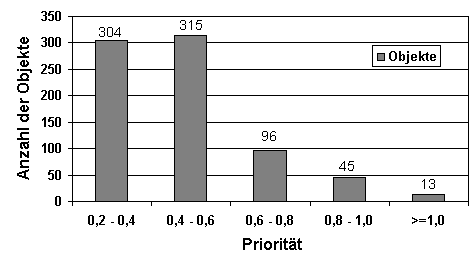
Abb. 6: Prioritätenreihung von 773 detailliert in einer Datenbank des Amtes der Tiroler Landesregierung ausgewerteten alpinen Einzelobjekten
Bereits im Bericht "Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung für Alpinobjekte" (1994) der Abteilung Wasserwirtschaft des Amtes der Tiroler Landesregierung werden verschiedene Vorgangsweisen hinsichtlich einer Prioritätenreihung vorgeschlagen. Diese Ausführungen enden mit der zutreffenden Bemerkung, dass eine Prioritätenreihung einer generellen politischen Festlegung bedarf, die wiederum abweichende Vorgangsweisen im Einzelfall zulässt.
Dr.DI. Bernhard Wett
Institut für Umwelttechnik, Universität Innsbruck
Technikerstr.13, A-6020 Innsbruck